Manche Bücher verwunden einen und ich fürchte, diese Wunde kann niemals heilen. Es sind nicht selten jene Bücher, deren Welt uns in der Kindheit oder Jugend näher ist als die Wirklichkeit; ihnen gegenüber erscheint sie manchmal wie eine Rohfassung, wie ein Entwurf. Nun sind diese Welten aber kein Ort, außer einem Spalt zwischen zwei Buchdeckeln, einer schmalen Pforte – zu einem Paradies, in dem wir immer willkommen sind und aus dem wir, letztlich, doch verbannt werden. In den Erinnerungen an den Aufenthalt dort finden wir Dinge von uns selbst wieder, die nirgendwo anders wirklich zu gedeihen scheinen. Aber sind das wir? Ist das die Sehnsucht? Die Hoffnung? Wie eine Wahrheit erscheinen sie, zu der es keine Lüge gibt.
Für mich ist Winnie der Puuh so ein Buch, ein Herzensbrecher. Was?!, werden jetzt manche sagen, dieses schöne Kinderbuch? Wie kann ein solches Buch denn verwunden? Auch wenn ich hier vorsorglich eine solche Reaktion imaginiere, hoffe ich eigentlich, dass niemand sich über meine Behauptung echauffiert. Vielmehr versteht. Denn ich glaube, dass alle Leser*innen wissen, wie sehr uns Schönheit oder Zärtlichkeit verwunden kann – zumal es nichts gibt, mit dem wir uns gegen sie verteidigen können (wer glaubt, Zynismus sei ein passabler Schild – i don‘t think so). Ich kann aber auch ausführen, warum dieses Buch mich so tief getroffen hat.
Winnie der Puuh ist, ich hoffe ihr wisst es, ein weiser Bär von sehr geringem Verstand, der nicht viel braucht und nicht viel will; eine Art Buddha, mit weniger Besonnenheit, dafür voller Staunen. Er lebt, umgeben von seinen Freund*innen, in einer freundlichen Landschaft mit Hügeln, Wäldern und erlebt allerlei Abenteuer, in denen das Abgründige durch die Eigenheiten, das Drollige und Freundliche, der Figuren und ihre Freundschaft zueinander aufgehoben wird.
Doch das Abgründige ist da und hat mich, aus welchem Grund auch immer, schon von Anfang an, bei der ersten Lektüre in seinen Bann gezogen. Ich weiß noch, dass ich mir als Kind sehr oft das Hörbuch (oder war es ein Hörspiel?) von Winnie der Puuh angehört habe, ich konnte nicht genug davon bekommen. Aber nicht (allein) das Liebenswerte und Komische war es, von dem ich nicht genug bekommen konnte, es war vielmehr so, als wären diese Geschichten ein Hinweis auf höhergelegene Daseinsformen; ein besonders intensiver Seins-Zustand, in dem ich so oft wie möglich aufhalten wollte.
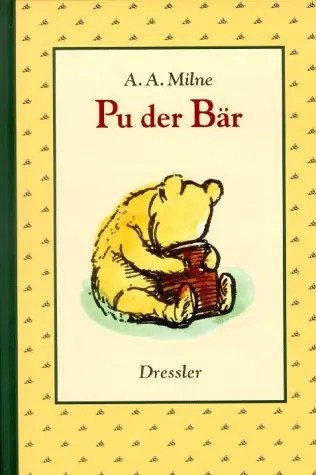
Alan Alexander Milne, Pu der Bär. Methuen, 1926.
Ich glaube, dass ich instinktiv gespürt habe, dass mich diese Geschichten, obwohl sie vom Zauber der Kindheit umgeben sind, auf ein Leben nach der Kindheit vorbereiten, von existenzieller Angst durchdrungen sind. Heute, wo ich kein Kind mehr bin, ist der Zauber zur Nostalgie geworden, einer starken Kraft; die existenzielle Angst dagegen hat nicht mehr dieselbe Wucht, aber mein erstes Unbehagen wird sie immer tragen. Immer werde ich es als Boten der ersten Idee davon erkennen, was über die Unbeschwertheit, mit der das Leben eines Kindes angefüllt ist, hinausragt.
Im Wesentlichen sind in Winnie der Puuh schon alle Gefahren und Beschwerlichkeiten des erwachsenen Lebens versammelt, ihnen fehlt nur die letzte Konsequenz, die Unabwendbarkeit; stattdessen enden die Miseren schnell oder wachsen sich gar nicht erst aus. Die Einsamkeit I-Aahs, die Hilflosigkeit Ferkels, die Überforderung Kängas als Mutter, die Beschränktheit Puuhs, die Unbedachtheit von Tiger und Eules sorgsam vorgespiegelter geistiger Adel, etc., es sind zutiefst menschliche Makel; in ihnen spiegelt sich das Bewusstsein um die fehlende Kontrolle über sein Schicksal, die damit einhergehende Bedeutungslosigkeit und letztendlich der Tod.
Natürlich sind diese Figuren und ihre Handicaps liebenswert, können Kindern aber meines Erachtens auch vermitteln, dass es okay ist, bspw. Angst zu haben, nicht alles zu verstehen, überfordert zu sein, keine Antworten zu haben; und es zeigt im Falle Eules auch gleich, wie Erwachsene oft mit derlei Unsicherheit umgehen: Rationalität.
Nun ist es aber nicht so, dass Erwachsene alles verstehen, alle Dinge auflösen können oder niemals überfordert oder einsam oder verängstigt sind. Bei ihnen ist es nur, auf gewisse Weise, nicht mehr okay (es ist selbstverständlich okay und lässt sich auch gar nicht verhindern, aber so wurde und wird es leider selten kommuniziert, weshalb leider viele Erwachsene diese Regungen tatsächlich nicht für angemessen halten, wenn es um sie selbst geht).
Für mich (und ich denke es gibt noch andere) machte dies Winnie der Puuh so interessant: es war ein Ausblick auf die Welt des Erwachsenseins, ohne die Behaglichkeit des Kindseins wirklich verlassen zu müssen. Es wehte mich ein Hauch der Turbulenz und Unübersichtlichkeit des Lebens an, ohne dass ich dadurch unwiederbringlich hineinpurzelte. Sehr oft wird das Unbekannte thematisiert, meist ist es furchterregend, erweist sich aber schlussendlich als relativ harmlos. Trotzdem wird nicht negiert, dass das Unbekannte etwas Unheimliches, sogar Bedrohliches an sich hat – und vermutlich immer haben wird.
Soweit. Warum aber fügte mir dieses Buch eine Wunde zu? Nun, diese Wunde fügte mir nicht das Buch allein, nicht eine seiner Geschichten zu (wobei das letzte Kapitel schon eine kleine Narbe hinterlassen hat), sondern vielmehr eine Erkenntnis, die sich nach einigen Aufenthalten in dieser Welt bei mir verfestigte: dass wir nur einander haben und sonst nichts.
Wie wohl fast jedes Kind, besaß auch ich Stofftiere, die mich eine Zeit lang intensiv begleiteten. Gerne würde ich jetzt ihre Geschichten hier ausbreiten, würde von der Delfinfamilie erzählen, die ich besaß, von einem Husky, ohne denn ich lange keine Reisen unternahm, von einer Schildkröte, die nach Jahren in ihrem Innern Drähte offenbare und von all den Orten, an denen ich mit diesen Plüschtieren spielte, bei den Großeltern und im Kinderzimmer, auf Reisen und vor allem: all dem Trost. Aber dies muss einmal gesondert geschehen.

Kuscheltiere besitzen, mit ihnen sprechen und leben, das kommt mir im Nachhinein wie eine kindliche Religion vor – und ich war sehr gläubig. So gläubig, dass ich es nicht mit viel Fassung trug, als diese Zeit zu Ende ging, als ich diese Zuflucht nicht mehr hatte. Ich erinnere mich noch, dass ich nach meinen ersten Panikattacken (damals muss ich Vierzehn gewesen) sein, noch einmal versuchte, mich zu meinen Stofftieren zu flüchten, aber nur ein tiefes Loch dort zu sein schien, wo früher die Trostfläche war, mit der sie mich sanft auffingen.
Was mich so erschütterte, war der Verlust eines Erbarmens, dass ich in der Nähe zu diesen Plüschtieren immer empfunden hatte. Und Erbarmen, das ist, so finde ich, etwas Essentielles. Es ist der Wunsch, der sich aus der menschlichen Erkenntnis über die Absurdität seiner Geworfenheit, seines Daseins in diesem Universum, ergibt. Wir alle wünschen uns, dass sich jemand unserer erbarmt, sei es nun ein Gott, eine Gelieber, die Eltern, die Mitschüler, größere Gruppen, einzelne Menschen, wer auch immer. So wie Menschen gemacht sind, was sie zu ertragen haben, ohne Alternative, verdienen wir, so kommt es uns vor, Erbarmen und wenn wir verletzt sind oder wenn es uns schlecht geht, suchen wir danach – und wer ist nicht an irgendeinem Punkt seines Lebens verletzt (es ist zu hoffen, dass es jede*r einmal ist, denn wer kein Erbarmen gesucht hat, der wird wohl auch keines empfinden können).
Erbarmen war auch die Erkenntnis, die ich aus Winnie der Puuh zog, weil ich anhand dieser Geschichten begriff, dass Erbarmen das einzige ist, das wir einander wirklich geben können. Ganz gleich ob in Form von Liebe, von Humor, von Rücksicht, von Beistand, von Lehren, etc., auf gewisse Weise sind das alles Formen des Erbarmens. Wir Erbarmen uns der Einsamkeit eines Menschen, seiner Ängste, seiner Verletzlichkeit, ja sogar seiner Fehler, seines Unwissens, seiner Befremdlichkeit. Und damit erbarmen wir uns gleichzeitig uns selbst.
Dieses Erbarmen zu spüren und zu geben, wird für mich immer die größte Zärtlichkeit bleiben. Und ich sehe diese Überzeugung vorbereitet in den Geschichten um Pu, den Bären, der in einer Welt lebt, wo alle einander helfen und im Prinzip nichts anderes tun, als sich einander zu erbarmen. Es gibt in Puuhs Welt all die Übel, die das Leben uns auferlegt, bis hin zum großen Abschied, aber es fehlen die Übel, die wir einander antun. Es gibt keine Grausamkeit in dieser Welt, keine Intrigen, lediglich hier und da ein kleines bisschen Eifersucht, Wut und Eingebildetheit. Und sie sind nie stärker als die Freundschaft, das Miteinander.
Im Jahr 1998 schrieb Thomas Michael Scanlon ein Buch über die Frage What We owe to each other. Für mich gibt es aber schon ein Buch (und mit The good place noch zusätzlich eine TV-Serie), welches diese Frage nahezu perfekt beantwortet: Winnie der Puuh. Es zeigt uns die Gefahren der Welt und schlug mir eine Wunde, die wohl nie verheilen wird. Aber es zeigt uns immerhin, was einer Heilung am nächsten kommt: ein Miteinander, in dem jede*r versucht, sich das Erbarmen für die anderen zu bewahren. Nochmal: mehr können wir einander nicht geben. Das ist letztlich die Botschaft fast aller Literatur und Kultur. Aber es ist ganz besonders die Botschaft eines Buchs über einen Bären von sehr geringem Verstand, aber mit großem Herzen, mit einem großen Gespür für das Erbarmen.
Habe die Ehr, Pu, der Bär.
Timo Brandt wurde 1992 in Düsseldorf geboren, wuchs in Hamburg auf, Studium am Institut für Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst in Wien. 2015–2017 Mitherausgeber der JENNY-Literaturzeitschrift, seit 2016 Literatur-Rezensent auf fixpoetry.com, signaturen-magazin.de und für Zwischenwelt, Kolik und Literatur und Kritik. Veröffentlichungen von Gedichten und Essays u. a. in Bella Triste, STILL, Metamorphosenund einigen Anthologien, 2019 erschien sein zweiter Gedichtband Ab hier nur Schriften. Er war Artist in Residence beim PROSANOVA 17 und ist Träger des Gisela-Scherer-Stipendiums 2019.Seit 2022 verantwortet er bei der österreichischen Tageszeitung Der Standard die Lyrik-Auswahl in der Wochenendbeilage Album. Zusammen mit anderen Bloggern gründete er 2022 die Instagram-Initiative Lyristix. 2025 erschien sein Debütroman Oder die Löwengrube in der Edition Keiper.


„Pooh“ zählt zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Ich habe es mit meinem Sohn – ohne Übertreibung – gewiss 50 mal in alle Richtungen durchgelesen. Und dabei auch meine Liebe zum Vorlesen, zum tiefen Einfühlen und Einspüren in Figuren, zum ihnen eine Stimme, eine Geschwindigkeit, eine Höhenlage, einen Rhythmus Geben erforscht und gewonnen. „Pooh“ berührt mich auf der zartesten und echtesten Ebene. Und wenn Christopher Robin zuletzt sagt „sie lassen mich nicht“ – dann weine ich. Immer. Von Herzen, Susanne Sommer, http://www.textbewegungen.at
LikeLike